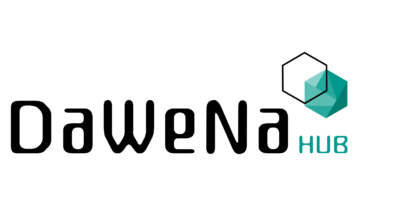Resilient statt karg: Starke Ökosysteme machen KMU zukunftsfest
Christoph Ziegler hat Politik- und Soziologie in Freiburg und Heidelberg studiert, war über sieben Jahre beim Projektträger Karlsruhe tätig. Seit 2024 unterstützt er beim Digitalen Innovationszentrum (DIZ) vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Akquise von Fördermitteln für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. „Was können wir von Vorreitern zu erfolgreichen Innovationen im Ökosystem lernen?“, heißt sein Thema beim DaWeNA-Koordinierungstreffen am 8. Oktober in Kassel. Wir stellen ihn mit einem kurzen Interview vor.
Wie bist Du vom Projektträger Karlsruhe zum DIZ gekommen?
Ich wollte mich unmittelbarer als bislang an der konkreten Umsetzung von Projekten und Initiativen beteiligen. Im Projektträgergeschäft gestaltest du durchaus, aber agierst eher im Hintergrund bzw. im Vorfeld forschungspolitischer Initiativen. Beim DIZ kann ich gemeinsam mit Unternehmen, Forschung und Verbänden konkrete Lösungen bauen, Partnerschaften orchestrieren und Ergebnisse direkt in die Praxis bringen. Mich reizt genau diese Schnittstelle aus Strategie, Transfer und messbarem Nutzen. Kurz: weniger flankierend, mehr gestaltend, mit klarer Verantwortung für Ergebnisse.
Was genau macht das DIZ?
Wir sind eine Agentur mit den Gesellschaftern Karlsruher Institut für Technologie (KIT), CyberForum und Forschungszentrum Informatik. Unser Auftrag ist, Innovationsakteure zusammenzubringen, KI- und Cybersecurity-Kompetenzen in die Breite zu tragen und Unternehmen bei Finanzierung, Projektaufbau und Skalierung zu begleiten. Wir gestalten Ökosysteme, identifizieren passende Partner, strukturieren Vorhaben (vom Use-Case bis zum Förderantrag), moderieren den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und helfen KMU, sich neuen Technologien anzunähern und diese zu implementieren.
Du sprichst oft von „Ökosystemen“. Was unterscheidet diese von Netzwerken?
Ein Netzwerk ist für mich ein loses Konstrukt von Akteuren, die sich kennen, aber nicht in unmittelbarem Austausch stehen. Ein Ökosystem hingegen ist wie in der Natur: Es hat lebende und nicht lebende Elemente – Menschen, Organisationen, Wissen, Infrastruktur, Geld – und diese sind voneinander abhängig, um zu überleben und sich weiterzuentwickeln. Viele KMU bewegen sich jedoch in „kargen Ökosystemen“: Kunden und Lieferanten sind da, aber der Zugang zu Wissenschaft, Testumgebungen, Daten oder Finanzierung fehlt. Das ist riskant, weil Märkte, Technologien und Rahmenbedingungen sich schnell verändern. Ein robustes Ökosystem kann solche disruptiven Veränderungen besser puffern.
Wie können Unternehmen ihre Ökosysteme stärken?
Zuerst muss erkannt werden, dass Veränderung notwendig ist. Darauf folgt eine ehrliche Standortbestimmung: Welche Bedarfe hast du, welche Stärken bringst du ein und wo liegen die Lücken, die dich ausbremsen? Danach gilt es, das Umfeld gezielt zu kartieren: Welche Partner ergänzen dich – Forschung, Start-ups, Mittelstand, Verbände oder die öffentliche Hand? Der nächste Schritt sind kleine, fokussierte Pilotprojekte mit klaren Leitfragen und messbaren Erfolgskriterien. Wichtig ist, diese Projekte systematisch auszuwerten, Lernerfahrungen festzuhalten und die Zusammenarbeit Schritt für Schritt zu professionalisieren und zwar mit klaren Governance-Strukturen, Daten- und IP-Regeln sowie belastbaren Finanzierungswegen. Mut zu Investitionen und Lernbereitschaft von Best Practices in deiner Branche zahlen sich aus und sind essentielle Faktoren. Entscheidend ist, die Bausteine zu kombinieren, die dein Ökosystem wirklich resilient machen.
Warum ist die Zusammenarbeit von Forschung und Praxis gerade bei KI so wichtig?
KI entwickelt sich extrem dynamisch und hat das Potenzial, Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern – im Positiven wie im Negativen. Gleichzeitig berührt sie hochsensible Felder wie Recht, Ethik, Sicherheit und Arbeitsorganisation. Forschung schafft hier Orientierung: Sie hilft, Risiken einzuordnen, robuste Verfahren für Evaluation und Monitoring zu entwickeln und Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie im betrieblichen Alltag nutzbar sind. Unternehmen wiederum bringen reale Daten, Domänenwissen und den Druck zur schnellen Umsetzung ein. Erst im Zusammenspiel entstehen KI-Lösungen, die nicht nur technisch funktionieren, sondern auch verantwortbar, regelkonform, sicher und skalierbar sind und damit echten Mehrwert erzeugen.
Interview: Eva Meschede