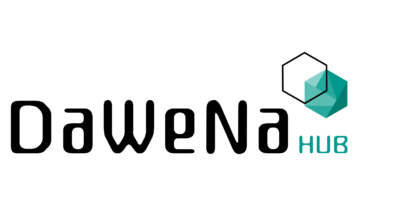3 Fragen an Enno Lang (BePro-CEND)
Enno Lang ist Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen der TU Darmstadt. An seinem Forschungsprojekt BePro-CEND sind 14 Partner aus Deutschland und der Schweiz beteiligt, um die zirkuläre Wertschöpfung mithilfe datenbasierter Technologien voranzutreiben.
Was ist dir in deiner Arbeit wichtig?
Mich motiviert, Ökonomie und Ökologie in industriellen Anwendungen zusammenzubringen. Ich finde es spannend, neue Technologien und Methoden mit dem Ziel zu entwickeln, dass Unternehmen damit nachhaltiger wirtschaften können, während sich zeitgleich wirtschaftliche Vorteile für die beteiligten Akteure ergeben. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, Ressourcen zu schonen, ohne wirtschaftliche Einbußen hinnehmen zu müssen. In der Geschäftsmodellinnovation muss es nicht immer ein neues Produkt sein. Manchmal reicht es zum Beispiel, wenn ich die Art ändere, wie ich ein Produkt anbiete. Vielleicht kauft ein Kunde es nicht mehr, sondern leiht es und nutzt die Funktion. Plötzlich haben wir ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das macht das Thema spannend.
Was machst du bei BePro-CEND?
BePro-CEND ist neben meiner Dissertation aktuell mein einziges Forschungsprojekt. Das Gute dabei ist, dass ich von Tag null an dabei war. Ich konnte das Projekt von der Skizzenphase bis zur Umsetzung mitgestalten. Das Konsortium vereint drei Forschungsinstitute und elf Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Gemeinsam arbeiten wir an Methoden, mit denen Unternehmen zirkuläre Geschäftsmodelle eigenständig entwickeln können. Dabei bauen wir nicht nur Theorie auf, sondern setzen bestimmte Anwendungsfälle mit Unternehmen in der Praxis um. Wir haben derzeit verschiedene Use Cases: von der Textilindustrie über Maschinen und Anlagen in der Lebensmittelproduktion bis hin zu klassischen Werkzeugmaschinen. Mich interessiert hierbei vor allem die Geschäftsmodellentwicklung in der industriellen Produktion.
Kann man an einem Beispiel beschreiben, wie dort Ökologie und Ökonomie vereinbart werden?
Der Maschinenbau ist ein ideales Feld, um das zu erproben: Ein Beispiel ist unser Kühlschmierstoff-Use-Case. In diesem Projekt entwickeln wir Technologien und Systeme, um Kühlschmierstoffe für Maschinen länger nutzen und wiederverwenden zu können. Der Kühlschmierstoff wird also nicht mehr einfach entsorgt, sondern möglichst lange im Kreislauf gehalten. Hierzu messen wir zum Beispiel die Ölkonzentration und steuern diese automatisch nach. Dadurch sparen wir Ressourcen ein und zeigen, dass Digitalisierung ein echter Hebel für Nachhaltigkeit sein kann. Kühlschmierstoffe klingen erst mal wie ein Nischenthema, aber wenn wir Prozesse digitalisieren, Ressourcen besser steuern und Produkte länger nutzen, können viele Unternehmen Geld sparen – und die Umwelt profitiert. Kreislaufwirtschaft ist natürlich kein Selbstzweck. Solche Initiativen werden nicht umgesetzt, wenn Produkte zwar langlebiger sind, Unternehmen aber dadurch Verluste machen. Wir müssen Geschäftsmodelle so anpassen, dass Nachhaltigkeit zeitgleich wirtschaftlich sinnvoll ist. Wenn wir das in unseren Pilotprojekten zeigen, können viele Branchen davon lernen. Wir wollen Unternehmen mit guten Praxisbeispielen überzeugen, denn so kann Kreislaufwirtschaft wirklich zum Standard werden.
Interview: Eva Meschede